


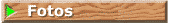




|

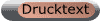
Diese Erzählung aus der Zeit der Romantik ist als Voraussetzung für das Abitur 2009 vorgesehen. Wie jede Auswahl von Themen und Literaturstücken ist auch diese willkürlich. Was immer sich die Vorschlagenden gedacht haben, beim richtigen Blick auf dieses Werkchen entfaltet es seine nichtaffirmative, subversive Kraft.
Bodo Gaßmann
Gedanken zu Eichendorff:
„Das Marmorbild“
Da ist nun alles drin, was volkstümlich zur Romantik gehört: Vom schönen Blumengebinde bis zur lauen Sommernacht, von der friedlichen Landschaft bis zu den verfallenen Mauern, die von der Vergangenheit künden, von der Verliebtheit in schöne Mädchenaugen bis zur Faszination der unübertrefflichen Schönheit einer antiken Göttin. Hier wird die Sehnsucht nach der Ferne ebenso bedient wie die Erinnerung an das heimatliche Glockengeläut. Der nächtliche Springbrunnen, die zauberhaften Schlösser, das Wipfelrauschen und die Naturseligkeit.
Als ich die Erzählung zum ersten Mal begann zu lesen, war ich zunächst abgestoßen von der Künstlichkeit der Situation und der sterilen Idealität der Imagination. Dann faszinierte mich wenigstens die Sprache des Dichters, seine poetischen Beschreibungen. Erst nach einer Weile spürte ich, ohne es noch ausdrücken zu können, warum es wirklich geht. Der Gehalt ist nicht auf der Oberfläche der Handlung offensichtlich.
Das Geschehen ist schnell erzählt. Ein junger Edelmann, namens Florio, kommt in die oberitalienische Stadt Lucca, wohnt einem Fest der Bewohner bei und sieht ein junges Mädchen, Bianca, das ihm zugetan scheint. Im weiteren Verlauf sieht er eine ideale Schöne, die ihn mehr fasziniert als das junge Mädchen. Auf einem Ball tanzt er mit dem Mädchen und erblickt zugleich die Schönheit wieder. In einem nächtlichen Ausritt meint er sie in der Marmorstatue der antiken Venus wieder zu erkennen. Er will sie sehen, bekommt durch Vermittlung des Ritters Donati auch ein Rendezvous. In einer herrlichen Villa unterhält er sich mit der Venus, die von einem großen Schwarm von schönen Knaben und Mädchen umgeben ist. Doch als er den christlichen Gott erwähnt, kommt es zu einem Gewitter, die Mauern der Villa zeigen dem erstaunten Florio ihre Morschheit und Verwitterung und die schöne Frau, die er als die antike Venus erkennt, verschwindet wieder. Florio kehrt in die Stadt zurück, um sobald wie möglich diese zu verlassen. Auf dem Weg in eine andere Gegend gesellt sich der Sänger Fortunato zu ihm, der bisher vergeblich versucht hat, ihn mit dem verliebten Mädchen, das er anfangs gesehen hat, näher bekannt zu machen. Auch der Oheim dieses Mädchens begleitet die beiden mit einem Knaben. Dieser entpuppt sich schließlich als das christliche Mädchen, das in Florio verliebt ist. Ein Happy End wird angedeutet.
Dem sensiblen, diskret-vornehmen Florio erscheint die verliebte Bianca am Schluss als eine „Quelle reinigender, befreiender und erlösender Kräfte“, während die antike Venus als Statue und vor allem als verlebendigte in seiner Traumbegegnung als „Inbegriff einer verwirrenden und betörenden Dämonie“ (Rösch, S, 192) sich offenbart.
Läge in der Verherrlichung des Christentums die Intention des Dichters, dann könnte man die Erzählung als eskapistische Nostalgie und reaktionäre Apologie dieser Religion abtun. Doch meine These gegen diese Konsequenz lautet: Die wahre Intention offenbart sich nur, indem man die Fantasiewelt Eichendorffs mit den realen Geschehen seiner Zeit, deren gerade im Entstehen begriffenen Strukturen bis heute fortdauern, konfrontiert und daraus die Konsequenzen zieht.
Florio ist ein Ästhet, er betrachtet die Welt mit künstlerischem Interesse an der Schönheit – auch wenn er selbst nur in der Kunst als Sänger dilettiert:
Wie kühl schweift sich’s bei nächt’ger Stunde,
Die Zither treulich in der Hand!
Vom Hügel grüß ich in die Runde
Den Himmel und das stille Land. (Marmorbild, S. 535 f.)
Zurück zum Anfang
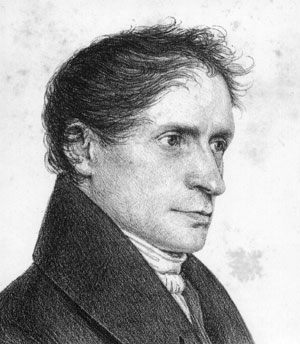
Joseph von Eichendorff
Wie immer seine ökonomische Lage ist, der Leser erfährt nichts Genaues, nur dass er ein Edelmann ist, einen Diener hat und sich das Reisen leisten kann: Er ist unabhängig und frei von allen materiellen Sorgen. Das ist nach Descartes die notwendige Bedingung, um ungestört nach Wahrheit suchen – oder wie bei Florio – nach Schönheit streben und seine ästhetischen Empfindungen bilden zu können.
„Florio stand in freudigem Erstaunen einen Augenblick still vor der unerwarteten Aussicht. (…) Versteckte Musikchöre erschallten da von allen Seiten aus den blühenden Gebüschen, unter den hohen Bäumen wandelten sittige Frauen auf und nieder, und ließen die schönen Augen musternd ergehen über die glänzende Wiese, lachend und plaudernd und mit den bunten Federn nickend im lauen Abendgolde wie ein Blumenbeet, das sich im Winde wiegt. Weiterhin auf einem heiter-grünen Plan vergnügten sich mehrere Mädchen mit Ballspielen. Die buntgefiederten Bälle flatterten wie Schmetterlinge, glänzende Bogen hin und her beschreibend, durch die blaue Luft, während die unten im Grünen auf und nieder schwebenden Mädchenbilder den lieblichsten Anblick gewährten. Besonders zog die eine durch ihre zierliche, fast noch kindliche Gestalt und die Anmut aller ihrer Bewegungen Florios Augen auf sich. (…)“ (A.a.O., S. 527)
Dienten solche Genrebilder zur gleichen Zeit (1817) den Schriftstellern, sich mit gewohnten literarischen Techniken der ungewohnten Erfahrungswelt der expandierenden Großstädte anzunähern, so ist bei Eichendorff von den Zumutungen der Großstadt nichts zu spüren, er verharrt in der scheinbaren Idylle des 18. Jahrhunderts, vertraute literarische Form und die das Gemüt stärkende Merkwelt sind noch identisch.
Dies gilt auch für die Erzählperspektive. Da ist das Individuum Florio, das ganz auf sich gestellt, seine Individualität ausbildet und dennoch als Gesprächspartner, mal fröhlicher, mal nachdenklicher Mensch, von der Gesellschaft gern aufgenommen und von einigen geliebt wird. Die angemessene Erzählperspektive wäre die Ich-Form oder, wie es hier tatsächlich ist, das personale Erzählen. Allerdings auch hier wieder in eigenartiger Weise. Die Einengung der Perspektive auf ein Subjekt hat im „Marmorbild“ nicht die Funktion wie in Büchners „Lenz“, deutlich zu machen, dass die komplexer werdenden Verhältnisse nicht mehr durchschaubar sind, nur noch von einem auf sein Selbst reduziertes Subjekt darstellbar sind. Sondern das personale Erzählen hat in Eichendorffs Novelle eine dramatische Funktion. Da der Leser nie mehr weiß als die Hauptfigur, aus deren Sicht erzählt wird, und da der Leser unmittelbar mit der dargestellten Objektivität – genauer mit dargestellten Subjektivität von Florio - konfrontiert wird, bangt und spekuliert er mit diesem, fühlt sich in ihn ein und erlebt mit ihm die überraschenden Wendungen des Geschehens.
Der Müßiggänger Florio steht diametral dem produktiven homo oeconomicus, der sich zu Eichendorffs Zeit durchsetzte, gegenüber. Während in England die Industrialisierung in vollem Gange ist und in Deutschland sie sich mächtig anmeldet, sodass alle idyllischen Verhältnisse zerstört wurden und die Bourgeoisie „kein anderes Band zwischen Mensch und Mensch übriggelassen als das nackte Interesse, als die gefühlvolle ‚bare Zahlung’“ (MEW4, S. 464 ), hebt Eichendorff mit seiner Erzählung „Marmorbild“ noch ein letztes Mal die ländliche und handwerkliche Idylle der oberitalienischen Landschaft hervor.
Der Winzer Jauchzen ist verklungen
Und all der bunte Lebenslauf,
Die Ströme nur, im Tal geschlungen,
Sie blicken manchmal silbern auf. (Marmorbild, S. 536)
Das ist keine realistische Beschreibung einer Lebensweise und der dazu gehörenden Landschaft. Die Stadt Lucca, ihre Menschen und ihre Umgebung gibt es nur in der Fantasie des Dichters. Nachdem die Menschen ihr Tagwerk getan haben, feiern sie ein Fest, mit aller naiven Verschwendung von Schönheit und Lust. Die Feste in Lucca sind das Gegenteil der ökonomisch bestimmten Erholung von der Arbeit, die kein Luxus gestattet, bestenfalls Komfort zur Regeneration der Arbeitskraft. Die Darstellung der Idylle ist bei Eichendorff auch kein „Idiotismus des Landlebens“ (MEW 4, S. 466), sondern die wehmütige Erinnerung an vergangene Zeiten, die angeblich besser gewesen seien.
Während also in der sozialen Wirklichkeit der beginnenden Industrialisierung die Lohnabhängigen bis zu 16 Stunden am Tag arbeiten müssen, selbst die aufstrebenden Unternehmer und Geschäftsleute hart arbeitende Menschen sind, die alle Energie daran setzen, produktiv zu sein und ihren abstrakten Reichtum in Form von Kapital zu vermehren, ist Florio der reine Müßiggänger und im kapitalistischen Sinn völlig unproduktiv, nach der herrschenden Arbeitsmoral ein Faulenzer.
„Er sprang von seinem Bett und öffnete das Fenster. Das Haus lag am Ausgange der Stadt, er übersah einen weiten stillen Kreis von Hügeln, Gärten und Tälern, vom Monde klar beschienen. Auch da draußen war es überall in den Bäumen und Strömen noch wie im Verhallen und Nachhallen der vergangenen Lust, als sänge die ganze Gegend leise, gleich den Sirenen, die er im Schlummer gehört. Da konnte er der Versuchung nicht widerstehen. Er ergriff die Gitarre, die Fortunato bei ihm zurückgelassen, verließ das Zimmer und ging leise durch das ruhige Haus hinab.“ (Marmorbild, S. 535)
Während in der Gesellschaft seit der Frühneuzeit eine Doppelmoral gilt, nach der man öffentlich vorgibt, alles für die Gesellschaft zu tun, der res publica zu dienen, aber privat das Gegenteil praktiziert: Seinen Egoismus und seine Laster frönt, ist Florio – aufs Äußerste das moderne Bewusstsein provozierend – völlig im Einklang mit sich selbst, seine gesellschaftlichen Beziehungen zu den neuen Bekannten sind harmonisch, individuelle Liebe etwas Selbstverständliches. Während in den bürgerlichen Trauerspielen des späten 18. Jahrhunderts das bürgerliche Mädchen als schwächstes Glied der Gesellschaft noch am Anspruch auf individuelle Liebe zu Grund geht und der Realist Keller in „Romeo und Julia auf dem Dorfe“ die Liebe an der Doppelmoral der Gesellschaft zerbrechen lässt, individuelles Glück ist nicht mit dem verinnerlichten Konkurrenzverhalten der Eltern, der dörflichen und städtischen Gemeinschaft vereinbar, – duldet der Oheim von Bianca nicht nur deren erste Liebe, sondern er bringt sie auch wieder mit Florio zusammen, nachdem dieser sich für die Ästhetik seines christlichen Ideals entschieden hat.
Die Venus verkörpert das Schönheitsideal der Antike. Die Antike kannte keine Liebe im romantischen Sinn, also die gefühlsmäßige Vertiefung der Gefühle zweier Menschen, das innige Verquicken zweier Seelen, wie es die Dichter des Minnesangs zuerst und dann seit dem Sturm und Drang die bürgerlichen Schriftsteller wieder konkretisierten und verherrlichten. Die Venus kann Florio nur mit ihrer äußeren Schönheit locken, mit den idealen Proportionen ihres Körpers – ansonsten bleibt sie als Charakter blass.
„Florios Blicke schweiften wie geblendet über die bunten Bilder, immer mit neuer Trunkenheit wieder zu der schönen Herrin des Schlosses zurückkehrend. Diese ließ sich in ihrem kleinen anmutigen Geschäft nicht stören. Bald etwas an ihrem dunklen duftenden Lockengeflecht verbessernd, bald wieder im Spiegel sich betrachtend, sprach sie dabei fortwährend zu dem Jüngling, mit gleichgültigen Dingen in zierlichen Worten holdselig spielend. Zuweilen wandte sie sich plötzlich um und blickte ihn unter den Rosenkränzen so unbeschreiblich lieblich an, daß es ihm durch die innerste Seele ging.-“ (A.a.O., S. 554)
Zurück zum Anfang
Die Kirchenglocken und ein christliches Lied von Fortunato erinnern Florio an seine Kindheit, die emotionale Vertiefung der Gefühlswelt. Das Verdienst des Christentums ist es nach Hegel, das Recht der Individualität erkannt und durchgesetzt zu haben. (Vgl. Hegel, S. 115) Die Aufwertung der individuellen Seele, die Entstehung des Gewissens und der Individualmoral ist dann die Bedingung, die romantische Liebe erst möglich macht. Dagegen erscheint die Venus als veraltetes Symbol der Liebe, das schließlich in die Vergangenheit zurück entschwindet.
„Über den stillen Garten weg zog immerfort der Gesang wie ein klarer kühler Strom, aus dem die alten Jugendträume herauftauchten. Die Gewalt dieser Töne hatte seine ganze Seele in tiefe Gedanken versenkt, er kam sich auf einmal hier so fremd, und wie aus sich selber verirrt vor. Selbst die letzten Worte der Dame, die er sich nicht recht zu deuten wusste, beängstigten ihn sonderbar – da sagte er leise aus tiefstem Grunde der Seele: ‚Herr Gott, laß mich nicht verloren gehen in der Welt!’ Kaum hatte er die Worte innerlichst ausgesprochen, als sich draußen ein trüber Wind, wie von dem herannahenden Gewitter, erhob und ihn verwirrend anwehte. Zu gleicher Zeit bemerkte er an dem Fenstergesimse Gras und einzelne Büschel von Kräutern wie auf altem Gemäuer.“ (A.a.O., S. 556)
Der romantische Eskapismus aus der Wirklichkeit, um wenigstens in der Fantasie die humanen Ideale und die christliche Utopie, die sich in der bürgerlichen Gesellschaft blamieren, zu retten, zeigt sich an der zentralen Stelle der Erzählung: Florios Rückkehr von der heidnischen Antike mit ihrem bloß äußerlichen Schönheitsideal in die vertiefenden, die ganze Person ergreifenden Liebesvorstellung des christlichen Zeitalters. Doch dieses Christentum hat überhaupt nichts mit dem offiziellen Christentum und der beamteten Verwaltung dieser Religion im 19. Jahrhundert zu tun. Wie in Ansätzen schon bei Walter von der Vogelweise ist für Florio das Christentum gekennzeichnet durch freie Liebe über Standesgrenzen und Konventionen hinweg, durch Lust, Schönheit der Natur, Fröhlichkeit, Heimat, liebevolle Beziehungen unter den Menschen und individuelles Glück. Fortunato empfiehlt seinem liebesunglücklichen Freund:
„Laßt das, die Melancholie, den Mondschein und alle den Plunder; und geht’s auch manchmal wirklich schlimm, nur frisch heraus in Gottes freien Morgen und da draußen sich recht abgeschüttelt; im Gebet aus Herzensgrund – und es müsste wahrlich mit dem Bösen zugehen, wenn Ihr nicht so recht durch und durch fröhlich und stark werdet!“ (A.a.O., S. 539)
Gegen das Christentum der freien Liebe und der Natürlichkeit steht das tatsächlich Christentum der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Es war ein Teil des absolutistischen Repressionsapparates: Die Religion sollte die unmündigen Untertanen in das Staatsgefüge eingliedern, es war deshalb Hauptfach an den Volksschulen. Man propagierte mit religiösen Mitteln das damals bereits absurd gewordene Gottesgnadentum und den absoluten Gehorsam gegenüber den Duodezfürsten. Wenn das Christentum auf der Höhe der Zeit war, dann predigte es die protestantische Arbeitsmoral, die nach Max Weber der religiös verbrämte Geist des Kapitalismus ist. (Vgl. Weber, S. 192 ff.)
Dagegen hat Florio keinen Herrn, er ist niemandes Untertan, er lebt die freie Liebe und sein Müßiggang, seine Differenzierung der ästhetischen Sensibilität und seine luxuriösen Konflikte um die Schönheit und Liebe der Antike oder die seines idealen Christentums sind deshalb bis heute eine Provokation gegen die Unterordnung aller Lebensbereiche unter die produktive Arbeitsmoral und ihren Zweck, der Produktion um der Produktion willen.
Wir, die wir die kapitalistische Arbeitsmoral verinnerlicht haben, fühlen uns durch die individuelle Zwecklosigkeit von Florios Dasein deshalb unangenehm und zugleich faszinierend berührt, weil wir heimlich spüren, dass der gigantische Zweck, das produktive Wachstum der Ökonomie, dem wir dienen, uns durch Eichendorffs Erzählung in seiner schrecklichen Sinnlosigkeit bewusst werden könnte. So wie in den Romanen Genets der Dieb auf die ungerechten Eigentumsverhältnisse in der bürgerlichen Gesellschaft hinweist, so bei dem Romantiker Eichendorff die Muße auf die Opferung der Lebenszeit für die Verwertung des Werts, die unser Leben seit zweihundert Jahren antreibt.
Doch die Romantik, auch die in Eichendorffs „Marmorbild“ kann bestenfalls die humanistischen Ideale von Liebe, Schönheit und Harmonie in der Erinnerung bewahren. Bleiben sie dort, dann ist die Lektüre dieser Erzählung bloßer Eskapismus aus der Gegenwart. So wie die Gestalt der Bianca blass bleibt, so ist die Fantasiewelt von Eichendorff steril gegenüber den humanen Potenzen, die selbst in der bürgerlichen Gesellschaft mit ihrem Poduktivismus stecken. Nicht im Rückschritt zu den Zaubergärten der Zeit vor der Industrialisierung kann heute eine konkrete Utopie liegen, sondern in der vernünftigen Gestaltung der Gesellschaft und ihrer Ökonomie. Nicht nur die Erinnerung bewahrt Unabgegoltenes, sondern auch in der heutigen Wirklichkeit gibt es ein utopisches Potenzial, das es zu erschließen gilt. Angesichte der leiblichen Gegenwart des Mädchens Bianca verschwindet endgültig die antike Gestalt der Schönheit: „Mit Wohlgefallen ruhten Florios Blicke auf der lieblichen Gestalt. Eine seltsame Verblendung hatte bisher seine Augen wie mit einem Zaubernebel umfangen. Nun erstaunte er ordentlich, wie schön sie war!“ (A.a.O., S. 563)
Zurück zum Anfang
Literatur
Joseph von Eichendorff: Das Marmorbild, in: Werke. Band 11. Romane, Erzählungen, München 1970.
Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Grundlinien der Philosophie des Rechts, Ffm., Berlin, Wien 1972.
Friedrich G. Hoffmann; Herbert Rösch: Grundlagen, Stile, Gestalten der deutschen Literatur. Eine geschichtliche Darstellung, Ffm. 1984.
Marx/Engels: Das Kommunistische Manifest, in: MEW 4.
Max Weber: Protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, München 2004.
|

Volltextsuche in:
Erinnyen Aktuell
Weblog
Hauptseite (zserinnyen)
Erinnyen Nr. 16
Weitere Internetseiten und unsere Internetpräsenz im Detail:

Die letzten Ausgaben der Erinnyen können Sie kostenlos einsehen oder herunterladen:

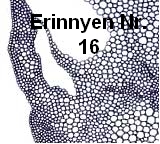
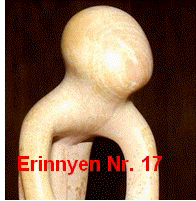
Erinnyen Nr. 18
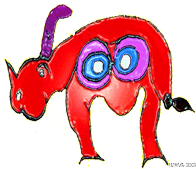
Die neuesten Artikel auf unserer Webpräsens insgesamt als Headlines auf dieser Website einsehbar:
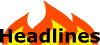
Eingreifendes Denken mit historischer Aktualität:
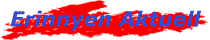
Nachrichten aus dem beschädigten Leben:

Unsere Zeitschrift für materialistische Ethik:

Unsere Internetkurse zur Einführung in die Philosophie:

Unsere Selbstdarstellung in Englisch:

Die Privatseite unseres Redakteurs und Vereinsvorsitzenden:

Unser Internetbuchladen:



|